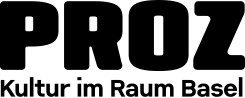PROZ, März 2024, S. 8/9
Sabine Knosala
Was viele nicht wissen: Das Filmstudio Basel am Aeschenplatz bietet als erstes und einziges Filmstudio der Schweiz Virtual Production an. Ein Augenschein.
Ein Feuerwehrmann schreitet durch einen brennenden Wald. In seinen Armen trägt er ein kleines Kind, das er soeben aus den Flammen gerettet hat. Während der Feuerwehrmann und das Kind von echten Menschen gespielt werden, gibt es den brennenden Wald nur virtuell: Er ist für den Kameramann sichtbar, wenn er durch die Kamera schaut, sowie für alle anderen am Set auf einem Referenzmonitor. Das Besondere daran: Wenn der Feuerwehrmann langsamer wird oder sich umdreht, bewegt sich der Hintergrund synchron mit. Für einen fliessenden Übergang zwischen realer und virtueller Welt sorgen echte Dinge im Vordergrund wie beispielsweise ein Baumstamm oder ein Feuer.
Wir befinden uns im Filmstudio Basel, wo gerade Szenen für ein Weiterbildungswochenende der Filmbranche gedreht werden. Denn: Das Filmstudio Basel ist das erste und bisher einzige schweizweit das sogenannte Virtual Production anbietet. Das stösst national auf Interesse, hat auch schon ein Team der SRF-Nachrichtensendung «10 vor 10» an den Aeschenplatz gelockt, wo sich das Studio in den ehemaligen UBS-Räumlichkeiten beim Hammering Man befindet.
Technik aus der Game-Industrie
Bei der Virtual Production, auch Mixed Reality Production genannt, wird der Hintergrund bei einer Filmproduktion komplett am Computer erstellt. «Die Technik dafür stammt aus der Game- und nicht aus der Filmindustrie», erklärt Alex Martin, Inhaber der Filmstudio Basel GmbH, die das Studio betreibt: «Die Schauspielerinnen und Schauspieler können sich in Echtzeit in einem fotorealistischen, dreidimensionalen Raum bewegen, wie es die Figuren in einem Computerspiel tun.»
Im Gegensatz zum Green Screen, bei dem real gefilmte Szenen und Hintergrund erst später, teilweise sogar nach dem Rohschnitt, zusammengefügt werden, bilden Schauspiel und Kulisse bei der Virtual Production von Anfang an eine Einheit.
Die Location ist dabei frei wählbar: Der Film kann irgendwo auf der Welt spielen – sei es nun am Südpol oder in der Savanne. Auch ein historisches Setting oder Fantasiewelten sind möglich. Weil die Kulisse von einem 3-D-Designer virtuell gebaut wird, kann sie während des Drehs noch verändert werden. «Wenn der Kameramann merkt, dass beispielsweise ein Schrank besser links stehen sollte oder es mehr Licht braucht, kann man das schnell ändern», führt Martin aus. Es könnten sogar Gegenstände hinzugefügt werden, sofern sie bereits in einer digitalen Bibliothek vorhanden seien.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Kostspielige Reisen an weit entfernte Destinationen entfallen. Dadurch wird der ökologische Fussabdruck kleiner. Martin schätzt, dass etwa 80 Prozent CO2 gegenüber einer durchschnittlichen Filmproduktion eingespart werden. Zudem ist das Filmteam nicht mehr von den Bedingungen vor Ort wie Wetter, Lichtverhältnissen oder Infrastruktur abhängig. Und es braucht im Studio nur noch circa ein Drittel des Personals, das man sonst bei einem On-Location-Dreh benötigt. Fazit: Aufwand und Kosten sinken massiv. Im Gegenzug wird die Produktion plan- und berechenbarer.
Allerdings ist einer der Vorteile auch der grösste Nachteil: Gerade bei grösseren Produktionen gehen zahlreiche Arbeitsplätze verloren. Zudem gibt es Einschränkungen beim Dreh: Eine Totale oder Massenszenen sind beispielsweise nicht möglich, wobei es auch hier Tricks gibt, um diese Probleme zu umgehen.
Zwei SRF-Co-Produktionen
Nichtsdestotrotz stösst die neue Technik auf regen Anklang: Im November hat Regisseur Thomas Imbach hier den von SRF co-produzierten Kinofilm «Lili» gedreht. Das historische Drama nach Arthur Schnitzlers Novelle «Fräulein Else» spielt im Engadin der 1920er-Jahre. Es ist der erste Kinofilm, der in der Schweiz zu 100 Prozent durch Virtual Production entstanden ist. Und schon bald soll mit dem Kinofilm «Sie glauben an Engel, Herr Drowak?» von Nicolas Steiner eine weitere SRF-Co-Produktion folgen. Beide Projekte wurden von der Basler Filmförderung mit je einer halben Million Franken unterstützt.
Ein grosser Erfolg für Alex Martin: Der 1967 geborene Basler begann seine Karriere als Drehbuchautor, schrieb beispielsweise die Geschichte für den ersten Schweizer Tatort, arbeitete danach für das deutsche Fernsehen und mit dem Film- und Theaterregisseur Helmut Förnbacher zusammen. Seit 2008 ist Martin selber als Produzent tätig (zum Beispiel beim Krimi «Manipulation» mit Klaus Maria Brandauer, 2011) und führt teilweise auch Regie. Das Filmstudio Basel eröffnete er im Sommer 2023. Die technische Ausrüstung hatte er bereits zuvor für seine eigene Thriller-Serie «Capelli Code» angeschafft, die dieses Jahr in Cannes lanciert wird.
Entsprechend zuversichtlich blickt Martin in die Zukunft: Er will vier bis sechs Produktionen pro Jahr in seinem Studio realisieren, darunter auch eigene Filme und Doku-Serien, «mit Kosten von zwei Millionen Franken, die aussehen, als hätten sie sechs Millionen Franken gekostet.»